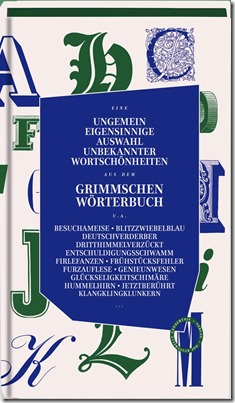Mit fortschreitendem Alter stellt sich immer dringlicher die Frage, wofür einer seine Energien einsetzen will, von welchen Arbeitsfeldern er sich besser zurückzieht, weil Aufwand - also knapper, kostbarer werdende Lebenszeit - und Nutzen - also der Gewinn an Zufriedenheit, zu dem wohl auch das Einkommen beiträgt - nicht mehr in vernünftigem Verhältnis stehen.
Im Journalismus war mein erwartbarer Gewinn an Zufriedenheit schließlich ebenso dramatisch geschrumpft wie meine Möglichkeiten, unerfreulichen Entwicklungen auf diesem Arbeitsfeld zu wehren. Die Situation war - insbesondere was das Fernsehen anlangt - jener zu vergleichen, in der ich mich seit Anfang der 80er Jahre in der DäDäÄrr befand: Mit unvertretbarem Kraftaufwand versuchte ich damals, quadratzentimeterweise auf Theaterbühnen Handlungsfreiheiten zu behaupten. Das erwies sich als sinnlos, weil immer genügend Bereitwillige verfügbar waren, mich zu verdrängen, meine Positionen zu besetzen. Der Staat konnte meine jederzeitige Ersetzbarkeit zur Erpressung nutzen, er versuchte, mich in den Mainstream des Gehorsams zu zwingen. Ich gab nicht nach, ich stieg aus. Die Nachfolger machten Karriere - einige besonders Stromlinienförmige auch nach dem Zusammenbruch der DäDäÄrr im vereinigten Deutschland; nicht nur sie verdarben mir die Lust, jemals wieder an Stadttheatern zu inszenieren. Mit der Hochachtung für die oppositionellen Autoren, Regisseure, Schauspieler, Bühnenbildner und anderen mutigen Mitarbeiter der Theater in totalitären Staaten wuchs meine Enfernung zu den bequemen Salonrevoluzzern des Westens. Ähnliches hat Liao Yiwu in China erlebt. Das Radiofeature über ihn und seinen Roman "Für ein Lied und hundert Lieder" zeigt, wie nahe sich der aus China und der aus der DäDäÄrr "entfernte" sind.
Ersetzbarkeit ist das Mittel der Erpressung in allen Sozialsystemen - das war keine gänzlich neue Einsicht meiner Tätigkeit als Journalist in den vergangenen zwanzig Jahren. Diese Einsicht, ihre sozialen Hintergründe, ihre Konsequenzen flossen in mein erstes Buch "Der menschliche Kosmos" ein: 2006 begann mit seinem Erscheinen mein Ausstieg aus dem Fernsehen. Es hatte wirkliche Höhepunkte, Erfolge gegeben, die dem Funktionieren demokratischer Strukturen und dem Auftrag öffentlich-rechtlicher Anstalten Ehre machten.
Die Entwicklung aber macht aus Journalisten zunehmend Erfüllungsgehilfen. Quotenvermutungen bestimmen fast ausschließlich, welche Themen ins Programm kommen; statt journalistisch distanzierter Haltung beim Berichten und womöglich quer stehender eigener Meinung beim Kommentieren richten sich Stellungnahmen an minder qualifizierten Prominenten oder politisch korrekten Experten aus. Es ist egal, ob die vermeintlichen Gewissheiten von heute sich morgen als Unsinn erweisen: Hauptsache schnellstens auf der "richtigen" Seite dabeisein, Hauptsache Quote.
Für mich wurde es höchste Zeit, mich aus diesem Geschäft zu verabschieden, nur noch das zu tun, was mit meiner Haltung vereinbar ist: So wenig wie der staatlich verordneten Monokultur im Osten werde ich der auf Konformismus zielenden Monokultur des Mainstreams zuarbeiten. Es gibt Wichtigeres - sogar Wichtigeres als Geld.
2022 ergab sich die Möglichkeit, als Autor für das von Oliver Gorus neugegründete Magazin "Der Sandwirt" zu arbeiten, im Oktober 2024 erschien - auch als Podcast - eine Version "3.0" von "Der menschliche Kosmos". Danach stellte sich die Frage vom Anfang dieses Artikels neu. Die insbesondere und seit dem Corona-Geschehen veränderte politische und Medienlandschaft legen mir nahe, meine "Restlaufzeit" nicht in den Schützengräben ideologischer Kriege zu verbringen. Deshalb werde ich dieses Weblog nicht weiterführen.
Gute Wünsche an alle Leser: Bleiben Sie selbständig im Denken und unerschütterlich im Ringen um die Freiheit - nicht nur der Meinung.